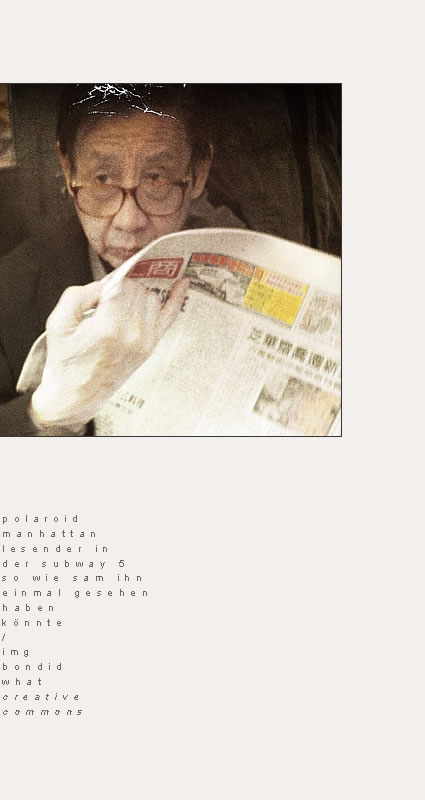Andreas Louis Seyerlein
∼
3.55 — Einige meiner Bücher scheinen über ein geheimes Gedächtnis zu verfügen. Wenn ich ein Buch mit Gedächtnis nach Jahren aus dem Regal nehme und auf einen Tisch lege, öffnet es sich einwenig, ein Raum entsteht, als würde das Buch nach einem Finger rufen, der genau in diesen Raum hineinfassen soll. Ich lese dort Sätze, die mir vertraut sind, vielleicht, weil ich sie oft wiederholte, woran sich das Buch noch immer erinnert. Vor kurzem öffnete sich ein Bändchen Elias Canettis genau in dieser Weise. Entdeckte: Es ist das Gute an Aufzeichnungen, dass sie frei von Berechnung sind. Sie sind zu rasch, sie hatten kaum Zeit, der Kopf, in dem sie entstanden sind, konnte noch nicht fragen, wozu sie zu gebrauchen wären. — stop
5.28 — Einmal machte ich einen Ausflug zu einer Tante, die seit über zehn Jahren in einem Heim lebt, weil sie sehr alt ist und außerdem nicht mehr denken kann. Der Flieder blühte, die Luft duftete, meine Tante saß mit anderen alten Frauen an einem Tisch und schlief oder gab vor zu schlafen. Ihr Gesicht war schmal, ihre Augenlider durchsichtig geworden, Augen waren unter dieser Haut, blau, grau, rosa, eine Gischt heller Farben. Ich drückte meine Stirn gegen die Stirn meiner Tante und nannte meinen Namen. Ich sagte, dass ich hier sei, sie zu besuchen und dass der Flieder im Park blühen würde. Ich sprach sehr leise, um die Frauen, die in unserer Nähe saßen, nicht zu stören. Sie schliefen einerseits, andere betrachteten mich interessiert, so wie man Vögel betrachtet oder Blumen. Es ist schon seltsam, dass ich immer dann, wenn ich glaube, dass ich nicht sicher sein kann, ob man mir zuhört, damit beginne, eine Geschichte zu erzählen in der Hoffnung, die Geschichte würde jenseits der Stille vielleicht doch noch Gehör finden. Ich erzählte meiner Tante von einer Wanderung, die ich unlängst in den Bergen unternommen hatte, und dass ich auf einer Bank in eintausend Meter Höhe ein Telefonbuch der Stadt Chicago gefunden habe, das noch lesbar gewesen war und wie ich den Eindruck hatte, dass ich aus den Wäldern heraus beobachtet würde. Ich erzählte von Leberblümchen und vom glasklaren Wasser der Bäche und vom Schnee, der in der Sonne knisterte. Dohlen waren in der Luft, wundervolle Wolkenmalerei am Himmel, Salamander schaukelten über den schmalen Fußweg, der aufwärts führte. So erzählte ich, und während ich erzählte eine halbe Stunde lang, schien meine Tante zu schlafen oder zuzuhören, wie immer, wenn ich sie besuche. Ihr Mund stand etwas offen und ich konnte sehen wie ihr Bauch sich hob und senkte unter ihrer Bluse. Am Tisch gleich gegenüber wartete eine andere alte Frau, sie trug weißes Haar auf dem Kopf, Haar so weiß wie Schreibmaschinenpapier. Vor ihr stand ein Teller mit Erbsen. Die alte Frau hielt einen Löffel in der Hand. Dieser Löffel schwebte während der langen Zeit, die ich erzählte, etwa einen Zentimeter hoch in der Luft über ihrem Teller. In dieser Haltung schlief die alte Frau oder lauschte. — stop
5. November 2013 14:08