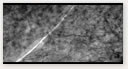Unter dem Motto „Wiederfund“ poste ich für gewöhnlich Passagen aus Büchern, die ich lange nicht gelesen oder überhaupt erst für mich entdeckt habe. Der folgende Text hingegen ist ein Auszug aus einem kleinen Aufsatz, den ich vor einiger Zeit zu Thomas Palmes mehrere tausend Zeichnungen umfassender Reihe „The Grip“ schrieb und kürzlich beim Aufräumen wiederfand.
Meinen Aufhänger bildete eine Gardinenpredigt von Milan Kundera gegen einen gewissen Künstlerkitsch, in deren Verlauf er mehrfach das Sch***-Wort verwendete. Wer also Kraftausdrücke dieser Kategorie zu schockierend findet, um sie innerhalb eines feuilletonistischen Textes für tauglich zu halten, lese bitte nicht weiter und übe Nachsicht mit der Verfasserin, die das, wenigstens für diesmal, anders sieht. Kunderas Kitsch-Definition finde ich immer noch zutreffend, und obgleich ich die Passagen zum Künstlerkitsch hier auslasse, wird doch auf das vorangestellte Kundera-Zitat Bezug genommen, denn einen weniger künstlerkitschigen Künstler als Palme konnte ich mir damals schwerlich vorstellen – und kann es eigentlich immer noch nicht. Also: Herzliche Grüße, lieber Thomas P., auf die Moosalpe oder wo immer Sie gerade zeichnen mögen.
„Der Moment der Defäkation ist der tägliche Beweis für die Unannehmbarkeit der Schöpfung. Entweder oder: entweder ist die Scheiße annehmbar (dann schließen Sie sich also nicht auf der Toilette ein!) oder aber wir sind als unannehmbare Wesen geschaffen worden. (…) Kitsch ist die Verneinung der Scheiße.“
Milan Kundera
„(…) Strenggenommen ist Schmerz ein Phantom. Gemessen an den Ansprüchen, die die Naturwissenschaft an die Existenz eines Phänomens stellt, gibt es ihn eigentlich nicht. Es gibt die Amputation und verlorene Gliedmaßen, die Operation und die Blinddarmnarbe. Dagegen kann man Schmerz so wenig beweisen wie Gott. Der Nachweis von Stresshormonen im Blut sagt weder etwas über seine Beschaffenheit noch über seine Qualität, nichts darüber, wie stark er ist und wie dauerhaft, oder wie widerstandsfähig gegen Betäubung. Schmerz ist ein Geheimnis, das ein Leidender dem anderen nicht enthüllen kann, gleichgültig, wie aufrichtig und kenntnisreich das versucht werden mag, gleichgültig auch, wie ähnlich der Schmerz des anderen dem eigenen von einer objektiven Warte aus gesehen wäre – wenn es denn eine solche gäbe. Doch dazu müsste es erst einmal eine Maßeinheit geben.
Umso schwieriger ist es, gegen ihn anzugehen. Die Pharmazie tut ihr Bestes. Die Psychologie tut ihr Bestes, die Philosophie natürlich auch. Hypnotiseure und Exorzisten tun ihr Bestes. Die Kunst tut, was sie kann.
Sie hat keine Macht, sondern ihre Grenzen, dieselben Grenzen wie der Schmerz. Sie existiert sozusagen hinter demselben Vorhang, da, wo die unmessbaren Dinge sind, und an dieser Stelle beginnt sie zu wirken, nämlich wie ein Placebo. Das Placebo ist die Antwort, die dem nicht messbaren Wesen des Schmerzes womöglich am besten entspricht, jene Stimulation durch Simulation, die Kunst wie kein anderes Mittel entfalten kann. Es ist vielleicht die einzige Antwort auf den Weltschmerz, dessen Haupteigenschaft ja gerade darin besteht, dass seine Ursachen am wenigsten zu beheben sind.
Die Zeichnungen Thomas Palmes sind hochwirksame Plaecebos. Sie sind gnadenlos und laut, sie zeigen den Schmerz so, wie ihn jeder, der nur mal eine Zahnvereiterung erlebt hat, kennt: als Feind des Glücks, als Gewalt, in deren Zugriff wir uns nicht aus freiem Willen befinden. Dafür steht der programmatische Titel dieses Bildwerks aus tausenden Werken: The Grip. Es zeigt die ganze allgemeine, unpersönliche und darum umso schmerzlichere Scheiße unseres einzigen kurzen Lebens mit seinen kleinen und großen Niedrigkeiten und seinem finalen Skandalon, seinem Ausgang ins Nichts, es brüllt diesen Gegebenheiten völlig angemessen sein kill the pain! entgegen, es fordert das Unmögliche und stimuliert den Mut, mit dem wir manchmal den Rücken straffen und sagen können: Doch! Auch dafür steht The Grip: Get a grip! Die Quelle solcher Wider- und Aufstandskräfte findet Palme zwischen Transzendenz und sinnlicher Welterfahrung, in einer hochwirksamen Verbindung zwischen Mystik und Kunst oder, um nur zwei der zahlreichen Porträts der Werkreihe zu nennen, überall zwischen Edith Stein und Johann Sebastian Bach.
Dabei verweigern die scharfkantigen, ausgezehrt wirkenden Gesichter und Körper der Palme-Gestalten, diese finsteren Geliebten, jeden falschen Heroismus. Sie tragen ihr Kreuz gern auch als Emblem auf der Haut, aber sie lächeln nicht ergeben dazu, das Kreuzsymbol ist hier ein Tattoo des Protests, und sollte es ein Muss geben, dann das des Lebens, zu dem der Schmerz als unerbetene Zugabe der Natur in Kauf genommen wird. Palmes Zeichnungen stellen keine Gegenentwürfe dar, noch bieten sie Ausblicke auf eine Alternative. (…)
In seiner überaus geräumigen Zweidimensionalität und schwarz auf weiß bietet der Weltanbau von The Grip Raum für: Einsamkeit, Zweisamkeit, Ausgesetztheit, Enttäuschung, Furcht, Hässlichkeit, Trauer, Beschämung, Zorn sowie für das Wissen darum, dass es nach den Regeln der Schwerkraft nur noch schlimmer kommen kann. Palmes schwarze Sonnenturbinen, seine schwindelerregend kreisenden Strichstrudel und rasenden Schatten, seine Gesten aus Kohle und Blei nehmen das Schmerzliche unserer Unannehmbarkeit in ihre Mitte und deuten sie in diesem Akt als zentrales Movens der Existenz. Sie verneinen die Scheiße nicht, die es bedeutet, ohne Aussicht auf etwas anderes als das Sterben vorher noch leiden zu müssen, sie erkennen das Leiden, das wiederum aus diesem Bewusstsein folgt, als wirklich an, in seinem vollen, d.h. sinnlosen Ausmaß, doch sie erkennen ihm keine Legitimation zu.
Stattdessen bejahen sie den Leidenden in allen seinen Reflexen und Verstörungen, als Traurigen oder Zornigen, als Geschlagenen oder Zurückschlagenden. Es ist ein sisyphoshaftes Aufbegehren in diesen Zeichnungen, nicht verwunderlich also die wiederkehrende Bewegung des Kreisens, des Trudelns in ihnen. Das ist die Spur des Steins, der nur deshalb immer wieder abwärts rollen kann, weil einer ihn ebenso oft aufwärts gerollt hat.“
6. Februar 2012 16:09