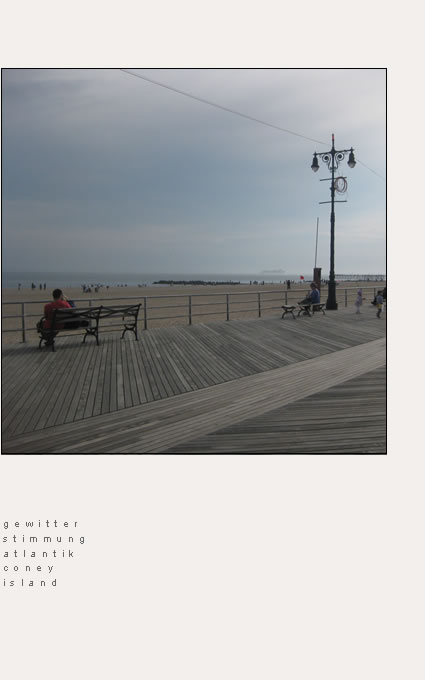Acht oder neun muss ich gewesen sein, als ich irgendwo am Tegernsee, in einem Dorf, wo ich als fremdes Kind mit Gleichaltrigen draußen spielen ging, auf dem Gelände eines großen Bauernhofs unvermittelt Zeuge wurde, wie dort ein Schwein, eine mächtige Sau, viel größer, als ich es war, getötet wurde. Es war ein Erlebnis, das mein ansonsten immer erschreckend löchriges Gedächtnis nie hat vergessen können. Ich erinnere mich an die Schreie des Tieres, die Gewalt, die es der ihm zugefügten Gewalt entgegenzusetzen versuchte, ich sehe das Kolbenschussgerät vor mir und fühle noch den Apparat, den ich in die Hand nahm, als ihn der Bauer oder Schlachter dem Schwein an den Schädel gepresst und abgedrückt und dann fallen gelassen hatte. Manchmal, wenn ich ein Schwein sehe, fallen mir, so will es mir scheinen, die Augen der Sau wieder ein, in meiner zerquälten Erinnerung sind sie in ihren letzten Augenblicken auf mich gerichtet, schließen sich nicht, sondern zeigen mir ihre Furcht, ihre Wehmut, ihr Erdulden und schließlich ihre Erlösung oder doch wenigstens Erleichterung.
Seltsamerweise hatte ich nie Mitleid mit dem Schwein. Ich fühlte mich ihm verbunden, ja fühlte – meinte ich – mit ihm. Gab es Erläuterungen seitens des Bauers, oder meiner Mutter? Ich weiß es nicht mehr. Ich sehe in meiner Erinnerung keine anderen Kinder, obwohl wir viele waren, die damals an dem Sommernachmittag dort auf dem Hof herumgespensterten. Ich weiß noch, wie erschüttert meine Mutter war, als ich erzählte, der Hinrichtung eines Schweins beigewohnt zu haben, und dass sie mich fragte, was auch ich mich selber fragte: Warum hast du das getan?
Ich denke, ich wollte verstehen, was das ist: ein Schwein, ein großes Tier, das getötet wird, auch in meinem Namen, obwohl es nichts getan hatte, was einen so barbarischen Akt rechtfertigen würde. Doch es ist das Gegenteil eingetreten, eine Leerstelle, eine leere Insel in meinem Gedächtnis, so kommt es mir vor, ist seinerzeit entstanden. Seit über fünfunddreißig Jahren fragen nicht mich die Augen des Schweins, sondern frage ich die Augen in meiner Erinnerung, goldenbraune, runde, tiefe Augen.
Seit ich Gedichte lese, ist es mir nur selten passiert, in Versen eine Antwort zu finden – einen Klang, eine Musik aus Bedeutungen finde ich dagegen viel öfter. „Lied aus reinem Nichts“ nennen, nach Versen von Wilhelm von Aquitanien, Michael Braun und Hans Thill ihre Anthologie, die deutschsprachige Lyrik des noch jungen 21. Jahrhunderts versammelt. Gestern las ich erstmals darin und fand ein bezaubernd-verstörendes Gedicht, um dessen Lob willen ich mir diesen Schweinesermon abgerungen habe.
Das Gedicht heißt zärtlich-lakonisch „Saurüssele“; geschrieben hat es Günter Herburger:
Das Wichtigste,
was man von Schweinen
lernen kann: kein Mensch zu sein.
Sie sind sehr sauber,
sehr gefühlvoll, ein wenig zänkisch,
kämpferisch, aber dann lieben
sie einander wieder,
und wenn sie weinen,
was sie gerne tun, schreien
sie kaum und lächeln dabei.
Einen Tag, bevor sie
geschlachtet werden sollen,
sind sie nervös und konfus,
rennen umher und beschmutzen sich.
Dann beginnen sie zu singen,
sehr tief und sehr hoch,
wir vermögen es nicht zu hören.
Kein einziges Schwein ist bekannt,
das alt, krank und mager
noch auf der Weide lebte,
ganz und gar nicht allein,
weil umgeben von Igeln,
sodass, wenn es stirbt,
es auch ein Häufchen wäre,
bedeckt von Blättern und Geschmeiß,
deren Konzerte
wir niemals vernehmen.
*
15. September 2010 12:45