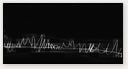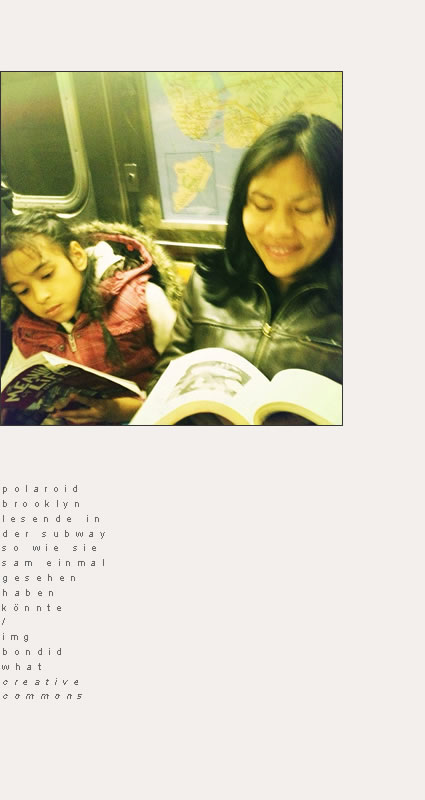10.12 — Von äußerst heimlicher Art und Weise, Gedanken zu notieren, berichtet Patricia Highsmith in ihrer Erzählung Der Mann, der seine Bücher im Kopf schrieb. Wenn ich nicht irre, so ruht der Mann, von dem in der Geschichte die Rede ist, stundenlang in einem Liegestuhl, indessen er lautlos an seinen Romanen arbeitet. Ein gleichermaßen Wörter eroberndes wie Wörter sicherndes Verhalten. Es ist schwierig für mich, in ähnlicher Weise vorzugehen, nahezu unmöglich, ich habe es versucht, ich komme je nur wenige Sätze weit. Nicht, weil ich vergessen würde, was ich bereits erzählte, nein, ich vergesse das Erzählen selbst, ich beginne zu konstruieren, die Sätze geben sich nicht die Hand wie üblich, jeder neue Satz scheint leblos zu sein, erstarrt, vertraut, erledigt. Wenn ich nun doch so heimlich wie möglich zu schreiben versuche, schreibe ich in ein Notizbuch, schreibe, sagen wir, einhundert Seiten weit, bis das Notizbuch mit Zeichen gefüllt ist. Was aber ist nun zu tun mit diesem Buch, das niemand lesen darf, nur ich allein, weil es ein privates Buch sein soll, weil das mein Wunsch, mein Wille ist, dass nur ich dieses Buch lesen werde, solange ich nicht entscheide, dass das Buch ein öffentliches Buch werden könnte. Ich müsste das Buch verstecken, was nicht wirklich möglich ist, oder ich müsste das Buch codieren, also ein zweites Buch verfassen, in dem das erste Buch enthalten ist, allerdings verfremdet durch eine Methode, durch einen Schlüssel (liliput), zu Aufbewahrung in meinem Kopf. Sobald nun das erste Buch in ein zweites Buch versetzt wurde, würde es möglich sein, das erste Buch verschwinden zu lassen, mittels eines Feuers beispielsweise. Man stelle sich einmal vor, ich würde meinen Schlüssel zur Methode der Entzifferung des zweiten Buches vergessen. Beide Bücher verloren, wäre ich gezwungen, das ist verrückt, mein verschlüsseltes Buch einer Behörde zu offerieren, die über ausreichende Rechenleistung verfügt, um meinen Text zur Lebzeit noch dechiffrieren zu können. — stop

5.25 – Seit Tagen denke ich an Robert Walser, an seine Schrift, an seine herausragende Begabung, kleinste Zeichen zu notieren auf jede denkbare Art von Papier. Der private Raum eines zierlichen Notizbuches, das als Institution wieder bedeutend zu werden scheint, könnte für Menschen wie ihn erfunden worden sein. Nehmen wir einmal an, Robert Walser und ich würden je ein Notizbuch von 4 cm Höhe und 4 cm Breite erhalten, 100 Blättchen Papier, das heißt, 200 Flächen zur freien Beschriftung, ein Notizbuch, das im Notfall verschluckt werden könnte, dieses eine Notizbuch also, nur dieses eine, um darin zehn Jahre zu arbeiten, ich wäre bereits nach ein oder zwei Tagen zu Ende gekommen, so voluminös meine Schrift im Vergleich zu Robert Walsers Schrift. Ich müsste von vorne beginnen, radieren, dann wieder schreiben. Mit der vergehenden Zeit würden die Seiten meines Buches dünner und dünner werden, transparent vielleicht, feinste Löcher entstehen, erste Zeichen, dass mein Notizbuch bald verschwunden sein wird. – Samstag. Früher Morgen. Leichter Regen. – stop
> particles
26. Juni 2013 18:14