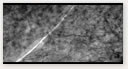Andreas Louis Seyerlein
~
0.22 – Kamele sind Tiere, die ich schon immer mochte. Sie erscheinen mir vertraut, als hätte ich einen Teil meines Lebens unter Kamelen zugebracht. Ihre großen Augen, die leicht aus dem Kopf hervorstehen, ihr samtig ledriger Mund, ihr Geruch, ihr warmer Bauch, das weiche dichte Fell. Ich erinnere mich, dass man mir vor langer Zeit einmal erzählte, ich sei während meiner Besuche mit meinem Vater im zoologischen Garten immer wieder gern bei den Kamelen gewesen. Auch soll mein Vater mich auf den Schultern getragen haben, während ich seinen großen Kopf mit meinen kleinen Armen umfasste. Merkwürdig ist, dass ich mich an keine Fotografie erinnere, die mich dort oben als einen stolzen Reiter zeigt, vermutlich deshalb, weil mein Vater vor Jahren der einzige Fotograf der Familie gewesen war. Es existieren überhaupt nur wenige frühe Bilder, die ihn und mich gemeinsam zeigen. Und so habe ich nun folgendes probiert. Ich habe eine Fotografie in meinem Kopf illuminiert, ein Dokument, das nie existierte und doch sehr wirklich werden könnte, wenn ich nur lange genug daran arbeite. Das Dokument ist eine schwarzweiß Aufnahme. Sie zeigt einen Mann in weiten dunklen Hosen mit hellem Hemd, das ist mein Vater. Auf seinen Schultern sitzt ein kleiner Junge, auch er trägt ein helles Hemd, Sandalen und kurze Lederhosen, das bin ich. Über uns verzweigt sich ein Ulmenbaum. Es ist ein mächtiger Baum. In seinem Schatten hinter einem Zaun stehen zwei Kamele, sie schauen uns an. Da ist noch ein Flamingovogel, hungrige Gestalt, der auf einem Bein mitten auf dem Spazierweg steht. Das sieht alles schon sehr gut aus, finde ich. Ich habe mir dieses Bild vorgestellt, bis ich es so genau vor mir sehen konnte, dass ich es auf einem vorgestellten Tisch drehen und wenden könnte. Mein Vater, den ich jetzt in dieser Weise sehen kann, war ein junger Mann, der lachte. Er zeigte in die Richtung der Kamele. Und auch ich zeigte mit einem Finger in die Richtung der Kamele und auch ich lachte. Es war Sommer. – stop
15.14 – Wie ein nahender Tod in den Bewegungen der Menschen auf Hospitalfluren, in Gesprächen, Nachrichten, Telefonaten, auch in den Blicken pflegender Schwestern und behandelnder Ärztinnen nach und nach erscheint. Das Licht des kommenden Endes wird sichtbar im Leiserwerden der Stimme des Sterbenden, ein Mund, der sich öffnet wie der Mund eines jungen Vogels, nach Luft suchend, nach etwas Wasser, Tee, Aprikose. Letzte zärtliche Berührungen, die Kühle der Glieder, wandernde Farben der Haut, liebevolle Sätze von Dank, Klagen, Weinen, Gebete. Ja, das Licht eines nahenden Todes erscheint nach und nach unaufhaltsam wie das Licht der Farben auf einer Polaroidfotografie erscheint. – stop
12. Mai 2012 11:38