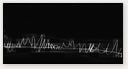Thorsten Krämer
Der Moment im Burgerladen, wenn du aus all den Variablen
endlich die Bestellung formuliert hast, und der Typ hinter der
Theke guckt dich an und sagt: Und du bist? — Ja, was bist du?
Schütze, 45, Vater zweier Kinder und noch vieles mehr, was dir
jetzt durch den Kopf schießt; du stehst da wie blöd und weißt
nicht, was du sagen sollst, bis dir dann klar wird, dass du vor allem
eines bist: zu verpeilt um zu begreifen, dass der Typ nur deinen
Namen wissen will.
25. Januar 2017 16:32
Gerald Koll
25. Januar 2016, ein Montag
Unterm Strich ein lausiger Tag. Verstopfter Magen, verstopft mit Süßigkeiten vom Sonntagabend. Träges Erwachen, träger Tag. Heute nur ein Aikido-Training statt zwei. Träges Ärgern, das sich einstrüppt ins Aikido. Ausgefranstes Existieren, zugebracht mit Lektüre, Anordnung der künstlerischen Puppenstube, Bauen an familieninternen Collagen. Schreibversuche: keine. Wie schafft man sich selbst ab? Es ist, als hätte ich den ganzen Tag meine Uniform gebürstet.
Das Training gab ich drein für den Breaking Bad-Ableger Better Call Saul, der nach ersten Zweifeln mit der Zeit immer besser wurde.
25. Januar 2017 11:04
Gerald Koll
24. Januar 2016, ein Sonntag
Beim Aufwachen träumte mir, ich habe der Kielerin N.J. Geleit gegeben, die allerdings ein wenig zarter und dünnblättriger wirkte als die irdische und erdige N.J. Ich fragte sie verhohlen lauernd (denn insgeheim begehrte ich sie), ob sie in letzter Zeit denn einen Mann zum erotischen Verkehr gesucht habe, annehmend, dass sie seit langer Zeit singulär sei. Das habe sie in der Tat, antwortete sie, es handele sich um den Barmann im Restaurant „Sarah Wiener“, dem bekannten Etablissement, worauf wir also gleich die besagte Lokalität neben dem Berliner Museum „Hamburger Bahnhof“ ansteuerten. Es hatte sich sogar ein kleiner Zug von Paaren hinter uns gebildet, deren Zusammenhörigkeit mir nicht klar war. Meinen leisen Verdruss überspielend, suchte ich nach einem Scherz, als wir das hellgoldige Vestibül betraten und nach dem glücklich Verehrten spähten, und kommandierte sektlaunig heiter, als wenn ich berufen sei, den Zug zu führen, hier ginge es nach links. Die Karawane hinter mir nahm es heiter, ich spähte weiter, doch bevor ich den Barmann ausmachen konnte, löste sich der Traum auf wie eine Blase, die an der Wasseroberfläche zerplatzt. Ganz kurz noch konnte ich festhalten, dass N.J. sich tatsächlich deutlich von der wirklichen N.J. unterschied, aber auch deutlich von Frau S. Mir war das peinlich, als würden mich solche Träume demaskieren.
Es ist noch vor 9 Uhr. Draußen ist der Schnee geschmolzen. Alles nass, nichts mehr weiß.
Hagners Buch Der Geist bei der Arbeit endet mit der beruhigenden wie enttäuschenden Erkenntnis, dass es derzeit nicht möglich sei, mittels wissenschaftlicher Messung dem Geist bei der Arbeit zuzusehen. Das hätte er mal gleich aufs Titelblatt schreiben sollen.
24. Januar 2017 12:28
Gerald Koll
23. Januar 2016, ein Sonnabend
Überraschend beschissen gestaltete sich das doppelpaarige Abendessen im austrischstämmigen Hause des geliebten Freundes und meisterlichen Charmeurs K. und dessen Gattin, die mutmaßlich nur auf Drängen des geliebten K. eingewilligt hatte, eine Einladung ergehen zu lassen, und nun ihre erschlaffte Tagesrestenergie dafür einsetzte, die Eingeladenen wegzubeißen. Oder hatte sie Vorladung verstanden? Es wurde jedenfalls ein Bewerbungsgespräch, bei dem Randexistenzen wie Frau S. & ich ihre bürgerliche Konformität ausweisen sollten. Mein glücklichster Moment kam, als die Gastgeberin mich fragte, worauf wir Deutschen denn damals bei der Bundeswehr gezielt hätten. Der Gast: „Österreicher.“
Immerhin waren Frau S. und ich, als wir die Treppe beinah kopfüber hinab eilten, überaus einig, so eine Pärchen-Scheiße künftig zu meiden. Später, sehr spät, legte sich Frau S. mit wuchtiger Libido ins Zeug, vielleicht auch in Anbetracht ihrer bevorstehenden neuntägigen Abwesenheit. Wie? dachte ich, jetzt noch Überstunden?
Zwei Mädchen aus Wales und die Liebe zum Kontinent. Wieder so ein Truffaut, der mir abhanden gekommen ist. Früher bettete mich der Film in sentimentale Andacht, gestern legte er sich auf mich wie ein schwerer staubiger Vorhang. Truffaut selbst spricht den Off-Erzähler. Schwermütig getragen wie ein trauriger Arzt. Als hätte er das Buch desinfizieren wollen gegen die mögliche Infektion durch Bilder.
23. Januar 2017 12:19
Markus Stegmann
Schmaler Korridor Kacheln
bestuhlt mit Plastik was will
sie schon wieder mit blauer
Leichtmetallkrücke Zuckertütchen
gratis nur dankt und geht
Schenkt nochmal ein
den Klaren eben rasch vom
untersten Regal neben dem
Mülleimer gegriffen und ebenso
schnell wieder dorthin zurück
Plastikmadonna mit Kind ragt
nur wenig aus der Wand hervor
schwebt schmucklos über den Köpfen
damit sich niemand daran stösst
öffnet den Grossraumkühlschrank
Bringt ein belegtes Brot mit dem
Messer zerteilt zum Schnaps schlägt
den Kaffeesatz raus was ist heut mit
euch los seid ihr überhaupt da dann
macht mal macht ihr mal
23. Januar 2017 00:14
Gerald Koll
22. Januar 2016, ein Freitag
Gestern M. getroffen. Ich sehe ihn zu selten. Er ist wieder größer geworden, gewachsen in Jahrhunderten der Ehre.
Aufgewacht nach zwei Träumen. Der erste mit Kitty (auch über sie hatte ich mit M. gesprochen), der zweite führte mich zu Freund L. nach Gettorf, und ich überlegte, ob ich zu L. über die Süderstraße fahren solle oder über die Felder. Während des Träumens schien mir diese Frage von immenser Bedeutung zu sein. Warum nur? Was hat sich seitdem in den Traumfalten verborgen? Auffälliger natürlich der erste Traum, der Kitty-Traum, in dem Kitty auf einmal im Zimmer stand. Schon war ich drauf und dran, sie zu umarmen, da schreckte ich zurück und rief mir zu: Frau S.! Doch da lag Kitty schon im Bett, nackt und greifnah. Ich widerstand mit Hinweis auf Frau S., worauf Kitty schmollend aufstand und sich hinauskomplimentieren ließ. Damit aber war es noch nicht vorbei: Ich ging noch Treppen hinauf in andere Zimmer, denn es war so, dass diese ganze Wohnung offenbar von einer Kitty-Vertrauten vermietet wurde … der Rest ist mir entschwunden. Zage erwacht: neben Frau S., und der Traum rief mir nach: ein Schuft bist du.
22. Januar 2017 23:54
Mirko Bonné
singing may wash away the blood of the lamb
Grace Paley
1
Es gibt dich nicht, überirdisches Licht
New Yorks, nur Himmelsweite, See und
die steinern überbaute Zunge der Insel.
Der Sturm vorm schwarzen Fenster greint –
es ist spät Herbst geworden in Manhattan.
Die paar Platanen am Broadway färben sich
rot und gelb, und immer noch jaulen beflaggt
mit Sternenbannern Löschzüge, klirren mit der
Totenfahne Ambulanzen durch die abendliche
Menge in den Thermopylen aus Boutiquen.
Davongetragen letzte Reste Wärme,
ist der Sommer ausverkauft.
2
Von allem getrennt, das du liebhast,
bleiben Lieder. Sie ziehen sich zurück –
einer singt vom New York State of Mind –
in ihre Sanftmut, ganz als legte sich ein
Lamm mitten auf dem Broadway nieder.
Eine Abendmaschine kreist über Queens.
Starenschwärme teilen sich und fliegen
aufs Meer. Durch seinen Regen irrst du
tiefer in Geschäfte für Bilder, für Sirenen
sinnlos verloren, ratlos mit einem Blick
telefonierend, täglich intangibler,
unberührbar dein Gesicht.
3
In den Sinn gebunden eines der Lieder –
ein kleines Kind im Lift nach oben weint –
lauschst du über den Wipfeln im 7. Stock
am Fenster deines regengrauen Turms.
Und du spürst, wie dir durch die Glieder
Blut hinrennt zum müden Herzen eines
Dobermanns, der träumt. Howard Hughes
verkauft Gedichte. Breakdancer tanzen zu
In the Mood. Einer sprüht an eine Wand
in Blumen immer wieder Gottes Namen.
Mädchen summen jiddische Reime …
Laub und Regen, Raub und Segen.
*
19. Januar 2017 16:54
Christian Lorenz Müller
Dieses Gedicht tut sich schwer damit
ein Toupet aufzusetzen.
Es will ihm nicht wirklich gelingen
richtig großkotzig zu sein.
Allein schon ein Adjektiv
wie great in den Mund zu nehmen
macht ihm wahrlich Mühe,
und es ist ihm schier unmöglich
einfach zu behaupten
andere Gedichte hätten keine Ahnung,
Hölderlins „Hälfte des Lebens“
hätte keine Ahnung, no clue, vom Herbst,
oder Jan Wagners Haikus
wüssten nichts von Regentonnen.
Aber da denkt das Gedicht
wahrscheinlich viel zu kompliziert.
Ein Gedicht mit einem Toupet
ist ein Gedicht, das keine Glatze zeigt.
– Also los, sagt sich dieses Gedicht,
lass endlich die Sau raus,
du kannst dir erlauben, Shakespeares Sonette
in der Übersetzer-Umkleide zu befummeln
und Inger Christenses „sommerfugle“
ins Panini-Album zu kleben,
du kannst dir alles erlauben,
weil du gleich im „Fisch“ gepostet wirst,
weil all die anderen Gedichte im Forum,
establishment, unter dir stehen werden.
Die allermeisten Anderen tragen ohnehin
längst ein Toupet.
19. Januar 2017 10:56
Gerald Koll
19. Januar 2016, ein Dienstag
Muttis Knie zwickte so arg, dass mich schaurige Bilder anfielen von einer gehlamen Greisin an der Seite eines tippelnden Greisen im Berliner Bahnhof, wo sie inmitten regen Gedränges ihre Köfferchen vergeblich über den Bahnsteig zu zerren versuchten, als wären die Koffer störrische Hunde. Dann das alte Paar, Seite an Seite einander haltend, am Zug, traurig aufschauend zum Fenster des Abteils, in das sie niemals würden einsteigen können.
Ich fuhr sie dann am Sonntag nach dem Frühstück nach Gettorf, spielte drei Runden Take It Easy und kehrte zurück nach Berlin.
19. Januar 2017 10:54
Konstantin Ames
Kenn ich welche, die nach Osten schaun. Kenn ich welche
sprechen in Mikrofone. Hübschis. Kenn ich welche
machen 30 [Liegestütz]. Kenn ich welche, die Gott (diesen Bock)
lästern; kenn ich welche, die Lyrik sagen, dann auch
politische Lyrik sagen müssen. Arme Teufel. Kenn ich
Grenzen. Grenzen der Kunstfreiheit, Doc, gibt es nicht.
Es gibt auch keine gelenkte Kunstfreiheit, auch keine
Kunstreligion. Fragt Hegel; wählt heute AfD.
Alle Künstler sind gleich! Künstler =
Der Tôpbàdd! Schleicht ins Bild wie Tonton.
Alle Künstler sind Scheichs; außer in Saarabien.
«Wo kämen wir da hin?!» (Doc)
Fragt Pussy Riot, Pawlenski, Ai Weiwei, …
Es gibt keine gelenkte Kunstfreiheit! Und für Lyrik, sagt
Jesuscowboy, in Reservaten, Prärien, Laboren reicht die Zeit nicht!
Für das Gedicht Alexander Karle
17. Januar 2017 11:16