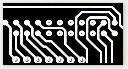this was all folly
T. S. Eliot
Waisen nannten sich die Drei, die mich mitnahmen.
„Hereinspaziert bei den Waisen vom Gutenmorgenland!“
Sie führten sich auf wie gerade noch davongekommen.
Die Wege waren aufgeweicht, „soft hands, das Wetter“,
meinte das Mädchen, das der Alte bloß Bunny nannte.
Sein Kollege saß vorn, im Mantel eines Katalanen,
dessen Leichnam jetzt in einer Benzinlache liege,
irgendwo in einer Kranwagenhalle. Der Stoff stank,
besonders nachts, wenn sie die Heizung aufdrehten.
Sie waren Blender, und ihnen gehörte nichts außer
dem Zeug, das sie am Körper trugen, und dem, was
sie grölten und ihnen kurz ihre Langeweile vertrieb.
„An was sich erinnern?“, fragte der Alte mal. „Alles
ist ein Film. Rückwärts läuft nichts.“ Nein, besser,
in einem kaputten Mitsubishi auf Schleichwegen
und hinein in Ortschaften fahren, wo der Trübsinn
an einem fraß wie Ruß am schmelzenden Schnee.
Bunny kreischte was, das aber niemand verstand.
Sie sprang raus und steckte vor einer Videothek
den Papp-Bond in Brand. Von dem Grünstreifen
zwischen zwei Parkbuchten flogen Spatzen auf,
als sie da tanzte, während ich fassungslos zusah.
Der Alte stieß die Fahrertür auf, sprang raus und
trat den brennenden Agenten wortlos zusammen.
Ich fing an zu brüllen wie sie, aber dozierte dabei
noch immer von „Passage zurück in die Geburt“,
schon lachte mich der ganze Klub still. Wir fuhren
durch leergefegte Nester in die Berge hinauf, feucht,
duftend nach Grün, knapp unterhalb der Schneegrenze.
Auf der Suche nach einer Tanke mischten die Drei jaulend
die Käffer auf, die den Katzen gehörten. Wir beschlossen
– oberste Regel: Sonnenbaden ist für Untote tabu! –,
tagsüber zu schlafen, in der Nähe von Wasser, und,
süß singende Stimmen im Ohr, nur nachts zu fahren.
„Ihre Haut ist so blass wie Gottes einzige Taube, Liebe,
wie eine schreiende Blume, Liebe, die stirbt jede Stunde.“
Sie sangen. Doch was sie sagten, hatte keine Bedeutung,
ihr Ziel war vielleicht eine Huldigung, möglich, aber kaum
die des göttlichen Kindes, eher die der Leere in ihnen.
War der Tank voll, „wie der Mond“, dann ging es weiter.
Kurz nach dem Festfressen der Kolben, kurz nachdem wir
den Hafen erreichten und im Schatten, den ein Frachter
durch das Nachmittagslicht auf die Mole warf, hielten,
fiel dem Alten hinterm Lenkrad plötzlich das Haus ein.
Für das Mädchen und Mantelmann war die Reise aus,
als sie Betten witterten. Das Land, endlich in Reichweite.
Ein Klepper leckte den Regen vom Zaun. Ich sah Vögel
auf kahlen Bäumen den Harsch von der Rinde hacken.
Als hätten wir die Wahl, schnitten wir uns Teller zurecht
und hörten wieder zu reden auf. Im Tausch mit den Bauern
gingen Schals weg, eine Posaune, und der Alte holte Lexika,
Tassen und Fotoalben aus dem Kofferraum, während Bunny
im Schneeanzug am Mittag am Campingtisch Pasta kochte.
Sie kam in mein Bett und sagte, sie mache alles, freiwillig,
wenn sie dafür meine Jacke bekäme. Ich gab sie ihr so,
und sie rannte runter, und ich hörte den Anlasser heulen.
Als ich wieder aufwachte, war es still. Das Licht stand
im Klappfenster. Im Garten des Nachbarhofs wuchsen
Blumen, die aussahen, als fotografierten sie das Gras.
Geborenwerden und Sterben sind manchmal dasselbe.
Ich wünschte mich nicht länger zurück. Ich lebte wieder.
Leben war mehr als Warten. Und so vergaß ich das Kind,
vergaß die drei Waisen und zuletzt das Gutenmorgenland.
6. Januar 2017 00:17