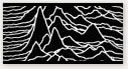Christian Lorenz Müller
Das gelbe Schwärmen der Palmkätzchen
unten am Fluss, das Summen
zahlloser Spaziergänger.
Ein Licht wie Fliegenleim,
von Joggern, Radfahrern umzappelt.
Im Schatten liegt noch Eis
auf einer Pfütze.
Dieser Sonntag ist dazu da
auf die Sonne zu warten,
auf das schmelzende Schillern
des Chitins, sein Aufglänzen
und sein Verschwinden.
13. März 2017 12:12
Gerald Koll
11. März 2016, ein Freitag
7:40 Uhr. Natürlich! Natürlich hat die Installation von final cut gestern Nacht nicht funktioniert. Nachdem ich alles eingegeben hatte und immer die gleichlautende Meldung erhielt, die Seriennummer sei ungültig, wusste und weiß ich, was ich schon die ganze Zeit gewittert habe: Fehlkauf, Betrug, Verrat. Habe ich nicht die ganze Zeit dieses schlechte Gefühl in der Magengegend gehabt? Unruhige Nacht mit Aussicht auf Konflikt mit dem Verkäufer.
9:35 Uhr. Im Postfach steckt ein Brief des Verkäufers: Wir könnten das Installieren auch gemeinsam machen.
13:50 Uhr. Die Installation scheint geglückt, mit Hilfe des Verkäufers, der 70 Minuten lang am Telefon aushielt. Netter Mensch. Mein Magen knirscht schuldbewusst.
11. März 2017 08:56
Andreas H. Drescher
NEIN
ich verirre mich nicht mehr Alles
Verfahren verfahrenen Verfahrens
fortgelernt kein Schritt mehr an
den Krebs von Kues verloren
Der Seitentanz queraus ist ein
gestellt ist scherenaufgehoben
und der Proviant umlagert mich
SCHLARAFF
Doch keine Taube brät sich durch
den Hirsebrei Die Steinebeterin
lüftet in Gewittern nur noch kalte
Löwen Was also soll ich weit
er dort wo Waschgezwungene mich
leinenwerfen noch vor Topp und
Takel ihre Narrenschiffe wetternd
11. März 2017 01:50
Gerald Koll
10. März 2016, ein Donnerstag
Einer dieser seltsam vereierten Donnerstage, in denen das Leben schrumpelt und kleiner wird. Diese Donnerstage haben es schon lange in sich. Irgendeine trübe Masse steckt in ihnen und zwingt mich in zeitverzehrende Ineffizienz. Heillos verirrt in Shikoku bzw. googlemaps und seinen japanischen Schriftzeichen. Dann verschluckt worden von den dreckigen Nebeln der Blogs, wo ich Informationen über „Final Cut Studio 3“ einholen wollte. Tappen in Gestöber. An solchen Donnerstagen könnte ich Schaumgummi essen. Ich will an Donnerstagen mehr, als Donnerstage mir geben können.
Aikido geschwänzt zugunsten von Tarantinos The Hateful Eight. Es ist längst nicht so langatmig, wie die Aikido-Banausen bemäkelt haben. Schneewestern verfügen ja schon naturgemäß über eine innere Majestät. Dazu Morricone und einige Veteranen von Reservoir Dogs (Michael Madson, Tim Roth), mit dem dieser Kammerspiel-Western ohnehin einiges gemeinsam hat. Die Story ist weniger verwickelt als ein Miss-Marple-Krimi, dafür grausamer und härter. Es ist eine Novelle, in deren Kälte man gemütlich erstarren kann. Kein Meilenstein und Meisterwerk, doch im Kleinen groß.
Vielleicht wohnt die Größe in einem kleinen Roman wie Ein ganzes Leben von Robert Seethaler, den mir die Schwester in die Hand fallen ließ. Bis ins Kleinste genau formuliert, und empfunden, unaufgeregt und scheinbar simpel.
10. März 2017 13:16
Gerald Koll
9. März 2016, ein Mittwoch
Erstmals seit langer Zeit ein wirklicher Frühlingstag. Am See gesessen und gelesen. Beim Spaziergang plänkelte es aus der Sonne mantrisch: „Nicht schlimm, alles nicht wirklich schlimm“. Dann schrieb ich Zweien, denen zu schreiben ich vor mir hergeschoben hatte in den Wochen der Bewölkung.
9. März 2017 09:19
Konstantin Ames
„Danke““für““die““humorartigen““Lektüreeindrücke„“!““Möglich““wäre““auch““die““Übersetzung““Sudelbuch““für““Roughbook““:“Lichtenzwerg“,“Aufklägerei“,““diese““Kiste““;““sonst““legt““sich““noch““ein““Schmierantentum““-„“Schalter““bei““solchen““um““,““die““die““Referenzfläche““nicht““kennen““.““(„“Wobei““:““Die““sind““eh““verloren“.““)““Es““ist““immer““so““ein““Dilemma““von““wirklich““kreativen““Menschen““:““Sie““machen““das““,““was““sie““machen““,““locker““vom““Höcker““,““so““lecker““(„“Wessiwort““)““,““dass““Stutzer““,““Strizzi““,““Streber““glauben““,““sie““können““das““auch““,““die““dann““aber““nicht““mehr““viel““können““müssen““.““Nur““noch““draufhalten““.““Bäm““-„“Bäm““-„“Bäm““.““Zeilenumbrüche““bitte““selbst““einfügen““!“
8. März 2017 10:19
Andreas H. Drescher
Die . Fernwehorte . gehen . mir
aus . wie . untreue . Religionen
Pfützenmeere . sammeln .. sich
um . verspätete … Gelassenheit
die . die Kinder aus der .. Lehm
gischt . ins Haus ruft ins . Haus
Die … Feuerwehren …. strömen
fern . der . Keller .. in die Rohre
und selbst .. der Sand von Rititi
ist morgens . nicht mehr feucht
morgens nach ….. der Fahrt der
Leguane in den .. Motorschaden
Denn der Teufel ….. wohnt jetzt
unterm …… Rücksitz trennt das
Polster auf …. und zieht ihn ein
GEDREHT …… INS ….. STUMME
7. März 2017 22:10
Hendrik Rost

Bruch
Aus allem, was keiner sagte,
kann eine Strömung werden,
ein Luftzug, eine Weltreligion.
Immer noch rinnt das Wasser.
Ein Wort nur, und deine Seele
ist flüssig: Aus vorsokratischen
Fragmenten wurde zuerst Fluss,
dann Weltbild. Ein Quantum Blut
aufs Volumen des Lake Superior
reicht aus, schon erkennt ein Hai
dich als Beute. Besteig einen Berg
und sag – nichts. Der Blick reicht
bis nach Lesbos, und es pulsiert
das Wort noch, nach dem Gesetz,
wie es schon galt, als du schliefst,
allein. Ganz allein bei den Scherben
am Ufer. Bevor die Vase zerbrach.
7. März 2017 12:11
Nikolai Vogel
Die Wolken sind so schnell,
keine Ahnung, wo sie hinmüssen,
nach Amerika vielleicht,
bevor dort alles verödet
noch mal Regen abwerfen,
Verschlossene ans Leben erinnern,
an Reisen mit neugierigen Augen
und die Errungenschaft, dass jeder Mensch
gleich sei vor dem Gesetz, weil es nur dann
keine Kriege geben muss, wenn man teilt,
bis jeder versorgt ist, und die Anstrengungen
darauf richtet, statt auf Zäune und Mauern
und das Wachstum der Wirtschaft.
Wenn wir die Wolken nicht ziehen lassen,
gibt es auch keinen blauen Himmel
oder nur noch stechende Sonne,
da Überschwemmung, dort Wüste,
die Welt will nicht nur rund sein, sie ist es.
Nikolai Vogel, 1. März 2017
6. März 2017 17:00
Gerald Koll
6. März 2016, ein Sonntag
Die Barke durch die Riffe lotsen / die Ungeheuer mit Namen zu bannen …
… besuchten mich die Schwestern zum Geschwistertreffen: eine Familienaufstellung. Erst zusammen in Giselle und seine weltfremde Ballettakrobatik. Eine Ouvertüre für unseren pas de trois. In Potsdam sitzen wir am Samstag lange im „Drachencafé“. Wir reden über Andere, um verhohlen über uns zu reden. Wir tasten uns an uns heran. An unser Grauen. Meine Blicke grapschen einer Schwester heimlich ans Kinn. Dort hat sich erstmals ein Hautsack ausgestülpt. Sie versucht ihn zu kaschieren. Als sie vor meinem Computer sitzt, bricht erstmals seit dessen Anschaffung das Bildvorschau-Programm zusammen; als sie mein Auto steuert, funktioniert erstmals seit dessen Anschaffung die digitale Zahlenanzeige. Ob die Schwester ein spezielles elektromagnetisches Feld habe? Sie sei sich dessen sicher, sagt sie, und wir …
… lotsen die Barke durch Riffe / die Ungeheuer mit Namen zu bannen …
… besuchte ich am Abend mit Freund K. Wagners Rienzi. Philip Stölzl hat Regie geführt und Rienzi als Hitler-Mussolini-Groteske inszeniert, was sehr naheliegt, weil Rienzi für Hitler 1907 eine so wichtige Oper war. Ohne Rienzi kein Hitler. Ungeheuer, wie sehr mich diese Ästhetik in ihren Bann zieht. Allein die Tragik des todesnahen und schon verdammten Rienzi, der kindhaft-irre mit seinen Modellbauten spielt, ist für mich entzückend-liebreizend. Was waren das für verquere 1840er Jahre, in denen Giselle und Rienzi entstanden, diese mythensatten dunklen Stoffe für verzweifelte Idealisten und ihre vernebelte Todessehnsucht …
… und wir die Barke durch die Riffe lotsen / die Ungeheuer mit Namen zu bannen …
… besuchten die Schwestern und ich heute Morgen das Museum „Ministerium für Staatssicherheit“ in der Ruschestraße. Es gab sie also wirklich, die Aktenkoffer mit eingebauter Kalaschnikow! Und aufregend: einige Täter äußerten sich vor der Kamera ganz unbefangen über ihre Tätigkeit. Einer bekam richtig leuchtende Augen, als er vom „operativen Vorgehen“ sprach. Dazu rieb er mit dem Daumen seine Zeigefingerspitze – ein Mann mit Fingerspitzengefühl. Es sei da, geriet er ins Schwärmen, eine solche Abwechslung gewesen … tja, aber dann fehlten ihm doch die Worte, und so beließ er es beim: „Man muss dabei gewesen sein … es war faszinierend.“ Man muss dabei gewesen sein – der Mann hat Gespür für Pointen.
6. März 2017 09:18