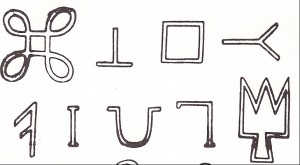Markus Stegmann
Dran seilte der
verdengelte knotet
lockerte lebrige Ringe
SCHREBER Periskop
die KLAVIATUREN
salmisch
singen er lodert
er hagt am
barmen belieben
FINGER derer
SOCKEN
luderte gelutschte
armer armer manches Hals
Helm ackerten
belagerte SCHOLLE verschwand
badeten solange ihre Backen
Safran Maibach erblindeten
so frass er
Erdige
magerten aber erscholl
erscholl
15. April 2009 22:45
Andreas H. Drescher
Zufrieden immer
zu
Er
schöpft vom Knoten
machen
Sonderlinge immer zwei
und zwei
Leg das als Rasselras
ter aus als Rasselras
ter zwischen Fingern
als
ein Zeichen
Zwei Socken
Einer immer kleiner
als der and
er
e
Diese halbgebeizten
Füße nichts
als Papier und Druck
er
schwärze
Komm
ruft das Komm
vergisst
den Mund zu ö
ffnen
Das Große Da
rum das
halber Wahrheit
halber
einsteint
Größer nie
Ein Knittern selbst
im Winken Pelz
aus
Borsten
Das ist die Zärtlichkeit
der Stachelschweine
Graben
diesen Trüffel
graben graben
Einen Schuh
als Schaufel
Auf
gefüllt
die Backen
taschen mit Ge
borste
Ein
Gelutscht in Erde wäre das verrutscht
15. April 2009 09:27
Hans Thill
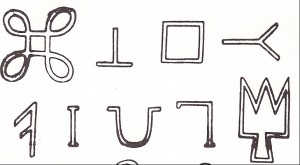
Liest jetzt ein anderes Buch, das ihn langweilt, aber voll von Woertern ist, aus denen etwas wachsen moechte. Er sieht neun Gesichter mit jedem Auge und im linken noch als gruenen Fleck den Rest eines Insekts. Er sagt sich, er gehe durch einen Traum, aber es ist nur das langweilige Buch mit den wachsenden Namen, das ihn aengstigt
Er hat eine Ahnung. Er beruehrt kein Kabel, keine Ader, keine Wasserleitung. Ein Sonnenstrahl macht noch keine Wueste. Eine Luft macht noch keinen Hurrikan
Die Befreiung des hl. Petrus. Der Kampf des Guten mit dem Boesen (Kopie). Die Hinrichtung von Sauls Moerdern
Er findet eine Tastatur fuer lange Saetze, Komma und Semikolon sind leicht zu finden, der Punkt muss generiert werden. Sein Code ist das Haus des Herrn in Notensprache: Do Mi Si La Do Re.
Er sieht den Himmel als Teppich. Den Garten als Grundriss des Himmels. Er hoert wieder Stimmen. Die Sprache der Wespen
Kublai Khan und Marco Polo zwei Penner im kurzen Hemd mit grosser Plastikflasche, einer schwarzen Tinte und einer Tuete zermahlener Kekse, bedraengt von Sheriffs in den unterirdischen Kanaelen Frankfurts Rohrpost
Er sagt: Vézelay ist ein Esel in Burgrund. Ein kahler Ruecken, gekroent von Steinen. Er sagt: Reime sind Insekten. Er sagt: der Morgen haengt an meinen Fersen, an meinen Fersen haengen Wolken, ein Duesenjaeger springt mit Laerm durch den Himmel, der ein Teppich ist
13. April 2009 10:12
Mirko Bonné
4
niemand liebte dieses
er)mit seinem
von auge geklemmt
in einen fels von
stirne.Nie
mand
liebte
groß die schnelle
dicke
helle schlange von einer
stimme diese
wurzel
gleichen beine
oder
fußhände;
niemand
konnte je hatte
je liebe geliebt wessen dessen
klimmender schultern komisches zwielicht
:niemals,nie
(mand.
Nichts
E. E. Cummings
Für Arne Rautenberg
*
9. April 2009 11:26
Andreas H. Drescher
Unter keinem
der einem keinem halb
gefiel
als Zeitungs
bild als
Aus
gerissenes
Ist das
so schlecht verwahrt
Wertvoller nie
als eine Verseferse
Oft
denkst du das nicht mehr
Mehr wäre
gescheiter
Er
innert sich wer er
erinnert sich
an diese Zu
kunft
Zu ist das
hat sich kein X aus diesem Y gespreizt
Nochnoch
kehrt das
ins Knie
ein
nie
mehr
aus
Das Lachen zwischen
Haut
und Haut
und doch die Handangst
Handvoll Angst
Das grosse
pfeffersüße Schweben
Erstickt im Kram
Zwangloser Zwang
Und dann
mit Verve aber
Wer
Das fehlt schon nicht mehr
das nicht mehr
und bleibt das Gegenteil
eines
Cocons
Der Abschlussabschuss Ein
schluss Knoten einen Finger drauf
Das lässt dich nicht
sie nicht
lässt siedich nicht
in diese ein
gesteinte Wabe
Auch so ein Lästerlaster
Nein
Hilft nicht mehr
innen von und nicht von aussen
9. April 2009 00:12
Rebecca Maria Salentin
Ich hatte angefangen zu tanzen –
Mit Kopfnicken
und Knieknicken
und tief
in mich blicken.
Wo rot zu blau wurde
Wind zu Stille
Knochen zu Salamandern
und du zu Schall.
– und es erst gemerkt
als der Song vorbei war
nicht mittendrin
Dass da flackernde Neonprints waren
und zuckende Schultern.
Dass da Nebel war
und aus Maschinen.
Dass da Shirts mit Flockdruck waren
und Brillenschlangen
und ein Apple.
Um mich rum.
Gewesen waren.
8. April 2009 01:06
Hans Thill
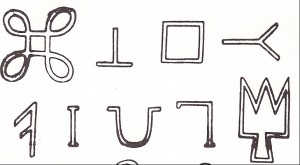
Lebt in den Geraeuschen zur Abwehr von Gedanken. Ein kurzes Husten und die Ideen waeren aus der kuehlen Kammer verschwunden. Sie sind bei den Gespenstern, die um Einlass in die Arche Noah betteln
Jeder Gedanke stiehlt etwas aus der Welt
Daniel in der Loewengrube. Angreifende Loewen. Die Welt in Anbetung vor dem Kreuz (Kopie)
Er liest ein Buch, das ihm nicht gefaellt. Er findet
einige Gedanken zu Schlaeuchen zusammengerollt und ein paar Geraeusche, die wie Kinder die Wiese hinaufkommen
Er erkennt die Fragen seiner fruehen Jahre. Er sieht sich als Schatten auf dem Ruecken liegend. Er sieht Voegel auffliegen und schliesst auf ein Geraeusch, das er nicht hoert. Er haelt das Buch in der Schraege, damit die Fluessigkeit ablaufen kann
Jetzt gefaellt ihm das Buch. Er findet eine Seite, die ihm perfekt erscheint. Es treten auf: der prahlerische Soldat, der Schmarotzer, der traurige Matrose mit dem Papagei. Der junge Verschwender, die Dirne treten nicht auf, haetten aber Raum genug, ein andermal. Dafuer gibt es den geizigen Vater, die verliebte Tochter, den albernen Diener. Der Barbar erkennt, dass das Buch geschrieben wurde, um diese Seite zu vermeiden. Dass sie aber schliesslich doch geschrieben und in diesem Buch versteckt wurde. Als Tuerschwelle, Balken
7. April 2009 23:12
Andreas Louis Seyerlein
7.28 – Nehmen wir einmal an, ich würde gefragt, ob ich vielleicht über ein weiteres Auge verfügen möchte, ein wirkliches drittes Auge, ein Auge für sich, ein Auge, mit dem ich in die Welt hinausschauen könnte, was wäre zu tun? – Ruhe bewahren! – Nachdenken! – Antworten! – Sehr bald antworten, jawohl ja, das wäre ein feines Geschenk, dieses Auge würde ich sehr gerne und sofort entgegennehmen. Natürlich würde das nicht so leicht sein, ich meine, die Übergabe eines weiteren Auges an meinen bereits existierenden Körper, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, nein, nein, das wäre sicher eine außerordentlich komplizierte Geschichte. Ein geeigneter Ort würde zu finden sein, an dem das brandneue Sinnesorgan an meinem Körper oder in meinem Körper montiert werden könnte, und ich müsste mich vielleicht zunächst entscheiden, welcher Art das Auge sein sollte, ein großes, strahlendes Schmuckauge beispielsweise, oder ein eher kleines, kaum sichtbares Auge, ein geheimes Auge, sagen wir, um unbemerkt die Welt um mich herum untersuchen zu können. An diesem schönen Nebelmorgen nun, ich bin noch nicht ganz wach geworden, würde ich folgendes fragen: Ist es eventuell möglich, das Auge rechter Hand in den mittleren Fingerknöchel nahe des Handrückens einzusetzen? Wann könnten wir beginnen? Sind Sie noch bei Verstand, oder wie oder was? – Ja, so würde ich wohl sprechen, genau diese Bestellung würde ich aufgeben. Stellt sich nun die Frage, was würde ein Auge dieser Art mit meinem Gehirn unternehmen? Würde es wachsen? Und wohin würde es wachsen? – Ich muss das nicht heute entscheiden!
> particles
4. April 2009 07:52
Marjana Gaponenko
Siehe, Mädchen, es erfüllt sich der Traum.
Man hörte dich sprechen: Vater im Himmel,
schaffe mir einen Bruder,
ein Tier das mir gleich sei,
das mich zerreiße im Kampf,
belebt von deinem Hauch,
so wie alles von meinem
jeder Zweig den ich breche,
jeder Stein …
Abends schaust du hinunter aufs Land,
und du schwimmst in seinem Blick,
in seinen untergehenden Augen.
Wo warst du, Mädchen,
woran hast du gedacht,
als du sangst „Bin ich allein?“
in den Brunnen, als sein Herz brach,
in jedem Riss dein Lied:
„Ich träume, doch ich liege wach.
Es umkreist mich mein Spiegel,
um den Apfel dreht sich ein Biss,
Traumbilder schaue ich,
treues Getier, alles meins …“
Und ja, du erhebst dich (nicht)
und du siehst: es erfüllt sich der Traum.
Ein Bruder eilt zärtlich zu dir,
dich im Kampf zu zerreißen.
1. April 2009 20:25
Carsten Zimmermann
wo immer er hinkam
befand er sich schon
es war ein rätsel wie er
das anstellte
als hätte er sich
aus dem hut gezogen
doch er beteuerte
er wisse von nichts
1. April 2009 08:16