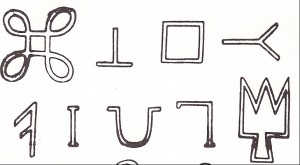Hans Test hatte nicht viel zu verschenken. Gestern Abend hatte er einen Satz gelesen, der ihn heute morgen auch noch nicht los ließ: »Enteignet die schamlosen Enteigner.« Daß Eigentum Diebstahl war, wußte er noch von dem Anarchisten Proudhon, dessen Buch mit dem Titel »Was ist das Eigentum?« ihm im revolutionären Portugal aus dem offenen Auto gestohlen worden war. Aus der selben Zeit fiel ihm ein, wie Landfried Schröpfer, ein experimenteller Heidelberger, einen Freund, der auf seinem geistigen Eigentum bestand, im Gedicht polemisch gefragt hatte: »wieso behältst Du Deine Texte nicht für Dich?« Es gab damals Zeitschriften mit Namen wie MOVENS.
Hans Test schaltete seinen Computer an. Bis der Bildschirm den in Kieselstein-Kreisen organisierten Zen-Garten zeigte, pulte er sich ein Stück Hornhaut von der Handfläche. Test würde später in den Verlag gehen. Er würde ein Manuskript lesen und korrigieren, mit dem Autor telefonieren und einen Termin ausmachen, in dem man die beträchtlichen Änderungen, die er für notwendig hielt, diskutierte. Er würde dann in der wöchentlichen Sitzung mit den Kollegen besprechen, was für die Förderung der einzelnen Titel zu untenehmen war. Er würde über die Gestaltung eines neuen Buchs sprechen, die Vertetersitzung vorbereiten.
Hans Test erinnerte sich, wie er bei einem Streitgespräch im Hinterzimmer einer Pizzeria ebenfalls in den siebziger Jahren einem Bauunternehmer die Berechtigung abgesprochen hatte, sich als jemand darzustellen, der arbeitet. Er nannte den biederen Badener einen Faulenzer, der seine Bauarbeiter ausbeutete. Ohne den Chef wäre alles sicher noch besser organisiert! Wenn die Bauarbeiter in eigener Regie die Baustelle übernehmen, werden Büroexistenzen wie Sie endlich überflüssig sein!
Einstweilen suchte Test aber nach dem Wort »Enteigner«. Im Netz fand er eine Debatte über die zunehmende Enteignung der Autoren durch die amerikanischen Einscanner von Texten vor. Er folgte dem link bis zur Seite http://www.textkritik.de/urheberrecht/
Hier stand der Ohrwurm-Satz als Überschrift eines Artikels der FR gegen die Übergriffe der Suchmaschine GOOGLE, verfasst von Roland Reuß, auch so ein Heidelberger, Literaturwissenschaftler, Entzifferer von Handschriften, Professor, Kopf des INSTITUTS FÜR TEXTKRITIK. In einem zweiten Artikel über den Veröffentlichungszwang für wissenschaftliche Texte, diesmal in der FAZ abgedruckt, bezeichnete Reuß sich listig als »Niemand«. »Ich bin dieser Niemand«. Odysseus spricht zu Polyphem. Reuß nannte den Veröffentlichungszwang in OPEN ACCESS eine »klammheimliche technokratische Machtergreifung.«
Im Fall GOOGLE ging es um einen Fall der Realgroteske, die Test, selbst fast kein Jurist, in mehrfacher Hinsicht ungerecht und nicht hinnehmbar fand, die aber trotzdem von allen Autoritäten offenbar als Vorgehensweise akzeptiert wurde. In den USA schloß die Suchmaschine mit dem schönen Dadaistischen Namen einen Vergleich mit Vertretern einer amerikanischen Autorenorganisation ab, der auch für ihn, Hans Test, hier in Heidelberg Geltung haben sollte, es sei denn, er mache dort, in den USA, einen Einspruch geltend, den er dann mit einem teuren Gerichtsverfahren gegen das mächtigste Unternehmen der IT-Branche durchzusetzen hatte.
Test fühlt sich an das Vorgehen von agrarischen Großkonzernen erinnert, die Erbinformationen einer Reissorte, die in Jahrtausenden beständiger Arbeit von Generationen indischer Bauern gezüchtet worden war, von schlecht bezahlten Chemieassistentinnen in einem Labor bestimmen ließen, um sie patentieren zu lassen und dann an eben diese indischen Bauern zu verkaufen. Dieselbe Strategie hier: Daumen drauf! Schon gescannt! Meins!
Im fraglichen Vergleich wurde jedem Autor für die Verwertung all seiner Bücher, die im Internet als Hintergrund für Werbebanner bereits veröffentlicht wurden und in Zukunft werden sollten, ein einmaliger Betrag von 60 Dollar angeboten.
Hans Test dachte, wenn einer Schmecker hieß und Vegetarier war, und ein Fleischkonzern nannte eine aus Abfällen hergestellte Streichwurst nach diesem Namen, weil seinen Werbestrategen nichts besseres einfiel, dann würde dieser Schmecker doch vielleicht etwas dagegen unternehmen? Oder wenn ein Motor entwickelt worden war, der mit Essig lief, benötigte man alle deutschen Weinberge zu Herstellung des neuen Kraftstoffs. Man verpflichtete also die Winzer zu Ablieferung ihrer Trauben und bot ihnen aber nur einen geringen Preis, weil man ja schließlich Essig produzierte und keinen Wein. Federführend ein Konsortium aus der Zentralkellerei der Winzergenossenschaften / Breisach und einem Ölmulti wie Exxon.
Die Abschaffung des wissenschaftlichen Verlagswesens, wie sie von Universitätsverwaltungen durch den Veröffentlichungszwang in OPEN ACCESS betrieben wurde, kam ihm mindestens so grotesk vor, wie die Vision eines mit Essig betriebenen Twingo. Nach einer durchzechten Nacht, Augen haben wie ein Twingo. Volltext trinken. Guglhupf essen, dazu einen Gewürztraminer. Das alte Europa, linksrheinisch.
Test wußte sofort, das waren alles hinkende Vergleiche. Stammelnde Verse, hinkende Vergleiche, krumme Sätze. Wenn die Lektorate bald abgeschafft waren, dann wäre all dies nicht mehr ein künstlerisches Mittel der Auflehnung gegen die Schrecken der Schrift, sondern im Gegenteil ästhetischer Alltag der Leser flacher Examensarbeiten, verfasst von alleingelassenen Schreibern. Federführend, ein seltsam altertümlicher Begriff.
Test nahm sich vor, dann wieder ordentlicher zu schreiben, alle Regeln schön brav einzuhalten, was ihm ein Greuel war. Und jetzt dachte er sich bereits aus, welche Banner bei jenen seiner Texte erscheinen könnten, die er selber ins Netz gestellt hatte. Das heiße Fleisch der Wörter? Der Schweinekiller NORDFLEISCH. Der Barbar von Vézelay? Irgendein elektronisches Spiel, von der Sorte, die gerade dabei war, die Grenze des Virtuellen zu überschreiten.
Auf einen Zettel notierte Test: »Miami, die Haie fressen unsere badenden Töchter, weil sie im leergefischten Meer nicht mehr genug Nahrung finden.« Noch so eine Idee von gestern Abend. Jetzt hatte er sich schon wieder nach Miami gebeamt. Die Imagination war immer noch ein rascheres Transportmittel als der schnellste Rechner. Test nahm sich vor, in Zukunft noch mehr im eigenen Kopf zu suchen und weniger im Netz. Und umgekehrt: Ohne die Kreativität der Einzelnen würde auch für GOOGLE bald nichts mehr zu posten sein. Er dachte an das freundschaftliche Auge-in-Auge eines Verwertungsvertrags, wie er im Idealfall zwischen Autor und Verleger abgeschlossen wurde. Wie viele seiner Freunde verstummt waren, weil sie keinen Verlag für ihre Texte interessieren konnten. Er dachte, daß man die wertschöpfenden Kleinunternehmer gegen die destruktiven Konzerne unterstützen mußte. Die Dynamitfischer der Weltmeere. Die Explorateure und Suchmaschinen. Die Claimabstecker.
Da Hans Test seine Texte nicht für sich behalten konnte, wollte er sie sich auch nicht einfach so nehmen lassen. Erneut ließ er seinen Browser kommen, rechts oben ins Suchfenster schrieb er EXPROP und fand wirklich einen Immobilienmakler dieses Namens in Mahopac, New York. Test blätterte ein wenig und dann erschien die passende Losung im roten Latein des 19. Jahrhunderts: „Die Expropriateurs werden expropriiert“ (Karl Marx).
25. März 2009 19:37