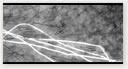In der Nähe von Abakan in Südsibirien leben viertausend Menschen mitten in der Taiga.
Als Anhänger eines ehemaligen Ikonenmalers, der sich als Reinkarnation Jesu Christi sieht, sind sie dazu angehalten, ein möglichst autarkes Gemeinschaftsleben zu führen.
I
Das Haus: Vier zum Rechteck gefügte Flöße.
Durch die Fenster wogt der Wald herein
wie durch Lecks.
Winters gischtet der Schnee durch den Garten,
der Rauch aus dem Schornstein
lotet den Himmel aus.
Und immer inselt der Glaube.
II
Täglich hinunter zum Fluss,
das Geläut der verzinkten Eimer
in den Fäusten, und jetzt, im Sommer
die Sonne als Klöppel.
Die Eimer glucksen, ihr Schwanken
an den ausgestreckten Armen
als es das steile Ufer hinaufgeht:
Der Mensch als ein Turm
an dem die Glocken hängen
die ihn zu sich rufen
oder auch nur zu dem Vordach
unter dem der Waschzuber steht.
Vielleicht verklingt die Klarheit
schon beim Gebrauch der Kernseife,
verklingt, wenn der Rücken schmerzt
und die Hände brennen.
III
Jeden Morgen, wenn du anspannst:
Dieses Zaumzeug der Autarkie,
diese Fahrt in die Freiheit
auf einem Wagen
der durch Schlaglöcher bockt.
Deine Lichtung in der dunklen Taiga,
das Heu, das so duftig-leicht auf der Wiese liegt,
das so drückend schwer wird
wenn es sich auf deiner Gabel bauscht.
Abends kein Trab mehr, Schritt
und unter dem Hintern
federt das Heu eine Müdigkeit herbei
die dich einnicken lässt.
Du weißt, wovon du träumst.
IV
Sonntags blendet das heiße Wasser
der Banja deine Haut.
Eine halbe Stunde lang
bist du blind für das Gemüse, das geerntet,
den Schuppen, der gebaut werden muss.
Die Seife erhellt deine Glieder
und dunkel verrinnt mit dem Schweiß, dem Staub
auch die Angst zwischen den Dielen.
Dein Erlöser ist aus rostigem Blech,
er verlangt nur ein paar Scheiter,
und du sagst, dass du danach
immer hinunter zum Fluss gehst, auch winters,
wenn dich der Dampf gen Himmel entrückt
und dein Haar zu Reif wird.
Du sagst, dass du trotzdem niemals zögerst
wenn du am Ufer stehst,
dass du es fast schon genießt
wenn die Kälte dich umkrampft.
7. September 2016 10:27